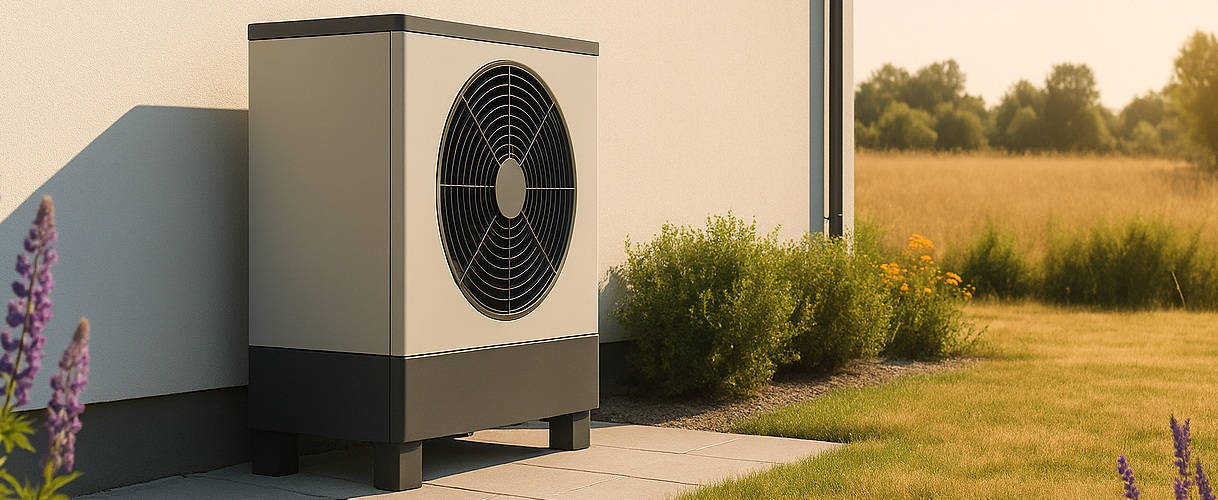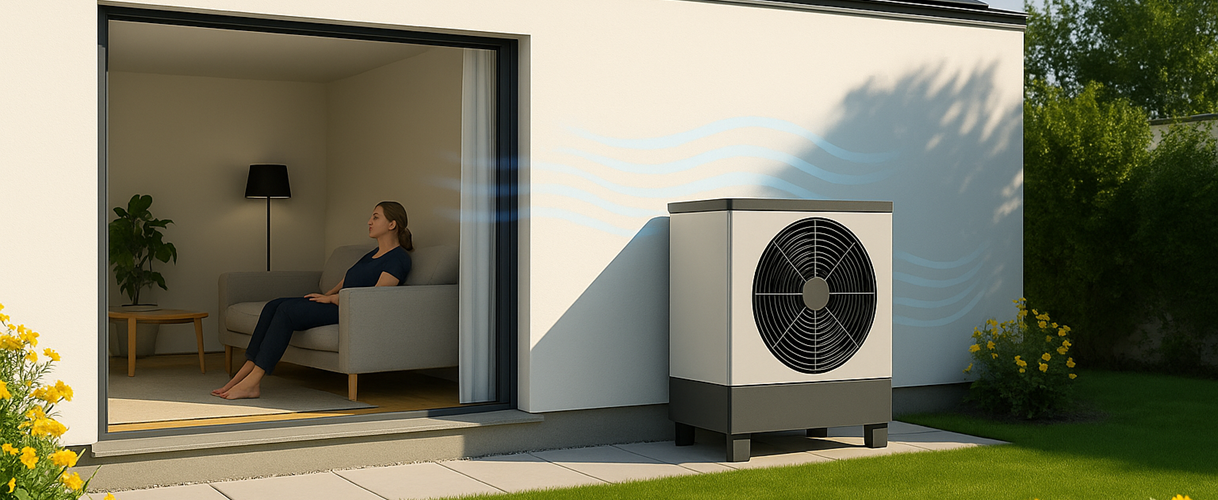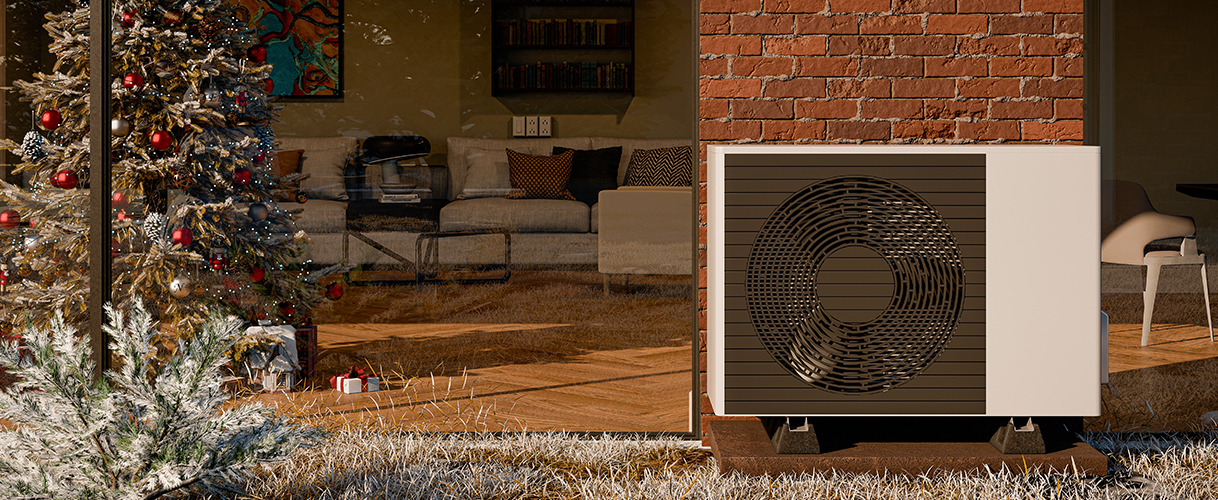Start in die Heizsaison: So stellen Sie Ihre Wärmepumpe optimal auf den Winter ein
Start in die Heizsaison: So stellen Sie Ihre Wärmepumpe optimal auf den Winter ein
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, beginnt für Ihre Wärmepumpe die wichtigste Zeit des Jahres: die Heizsaison. Damit Ihre Anlage zuverlässig, effizient und kostensparend durch den Winter arbeitet, lohnt sich im Oktober ein gründlicher Check – sowohl technisch als auch energetisch.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Wärmepumpe optimal auf die kalte Jahreszeit vorbereiten und welche Einstellungen Sie jetzt kontrollieren sollten.
1. Warum ist der Oktober der ideale Zeitpunkt für den Heizungscheck?
Im Oktober ist es in den meisten Regionen kühl genug, dass die Wärmepumpe bereits im Heizbetrieb läuft – aber noch nicht unter Volllast. Perfekte Bedingungen, um:
-
✅ Einstellungen zu überprüfen und anzupassen
-
✅ Fehler frühzeitig zu erkennen
-
✅ den Energieverbrauch zu optimieren
So vermeiden Sie unnötige Kosten im Winter und stellen sicher, dass Ihre Anlage unter hoher Last stabil läuft.
2. Die wichtigsten Einstellungen im Überblick
🔧 Vorlauftemperatur prüfen
Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Typisch sind:
-
Neubau / Fußbodenheizung: 30–35 °C
-
Altbau / Heizkörper: 45–55 °C
💡 Tipp: Lassen Sie Ihre Heizkurve ggf. neu einstellen, um Energie zu sparen.
🔧 Zeitschaltfunktionen aktivieren
Nutzen Sie tageszeitabhängige Heizphasen – z. B. nachts absenken, morgens und abends hochfahren. Das spart Strom und erhöht den Komfort.
🔧 Heizkreispumpen und Filter prüfen
Verunreinigte Filter oder falsch eingestellte Pumpen können die Effizienz massiv senken. Ein kurzer Check durch den Installateur lohnt sich.
3. Warmwasserbereitung anpassen
In der kalten Jahreszeit steigen oft die Anforderungen an Warmwasser. Wichtig:
-
⚙️ Warmwassertemperatur kontrollieren (idealerweise 50–55 °C, ggf. mit Legionellenschutz)
-
🔄 Zirkulationszeiten optimieren, um Wärmeverluste zu vermeiden
-
💧 Speichergröße prüfen, wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen
4. Außenbereich und Außeneinheit prüfen (bei Luft/Wasser-Wärmepumpen)
🍂 Im Herbst droht Laub und Schmutz die Außeneinheit zu blockieren – das kann die Effizienz erheblich verschlechtern.
-
Entfernen Sie Laub und Äste
-
Prüfen Sie den Mindestabstand zur Hauswand (Luftzirkulation!)
-
Kontrollieren Sie, ob sich Wasser ansammelt – Frostgefahr!
5. Energiesparpotenzial aktivieren
Gerade in der Heizsaison können Sie mit kleinen Anpassungen bares Geld sparen:
-
✅ Heizkurve flacher einstellen
-
✅ Nachtabsenkung nutzen
-
✅ Raumtemperatur gezielt regeln (1 °C weniger spart ca. 6 % Energie)
-
✅ PV-Strom für Heiz- und Speicherzeiten einplanen
🔋 Wer eine PV-Anlage nutzt, kann über smarte Steuerung den Eigenverbrauch maximieren – ideal für Haushalte mit Batteriespeicher.
Fazit: Mit dem richtigen Setup entspannt durch die Heizsaison
Der Oktober ist der perfekte Zeitpunkt, um die eigene Wärmepumpe auf den Winter vorzubereiten. Mit gezielten Einstellungen, etwas Wartung und ein paar Energiespartipps läuft Ihre Anlage effizient, zuverlässig und kostensparend durch die kalte Jahreszeit.
Wer jetzt handelt, profitiert den ganzen Winter.